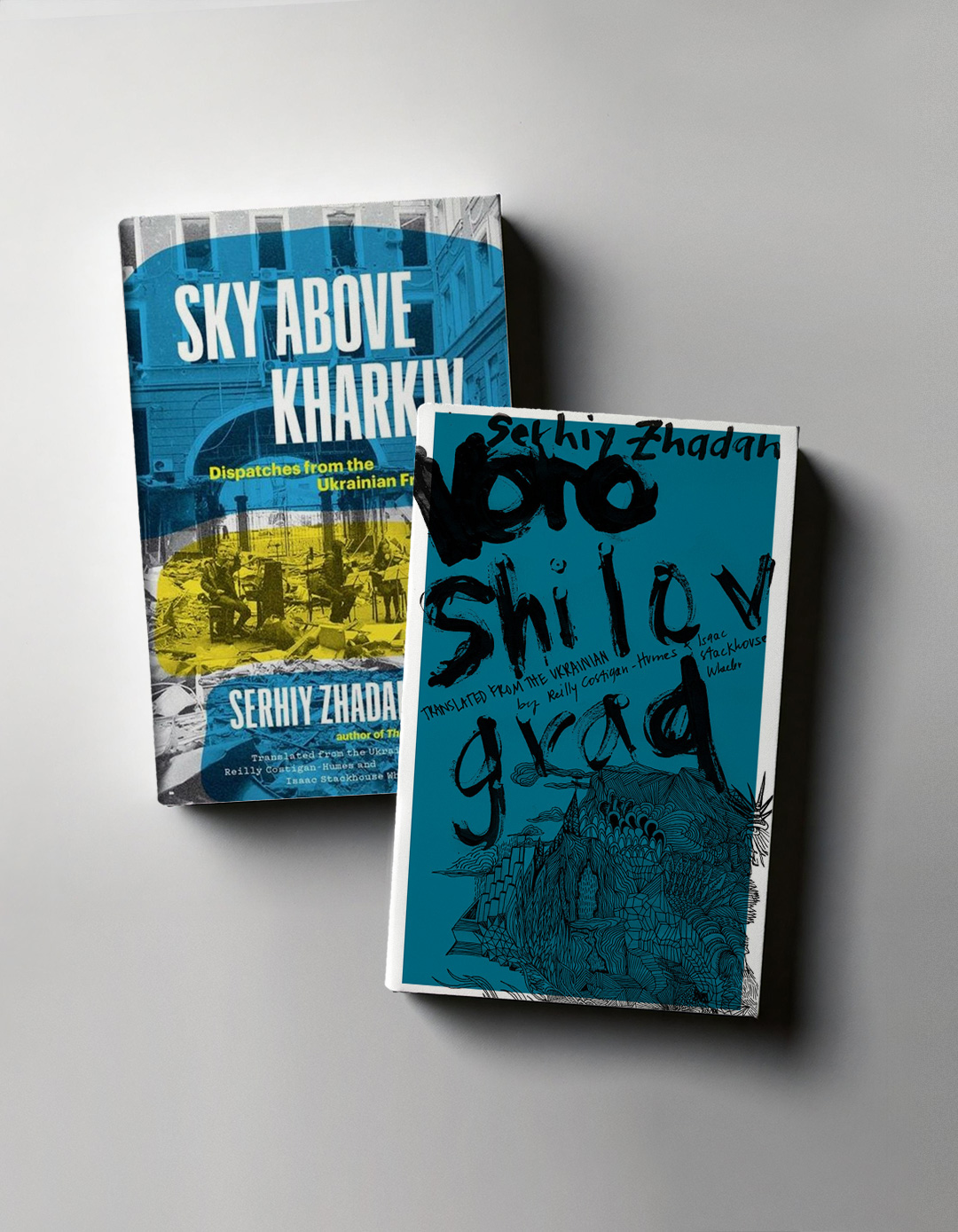Journal
Dezember 20, 2024
Lesezeit: 12'

Wir brauchen profitablen Journalismus!
Warum weder öffentlich-rechtlicher Journalismus allein noch langfristig von Stiftungen geförderte Redaktionen die Demokratie retten werden. Der Media Forward Fund eröffnet in Deutschland, Österreich und der Schweiz innovativen Medien einen Weg aus der Krise – mit der ERSTE Stiftung als Gesellschafterin.
»Das Prinzip Trotzdem« hat Roger de Weck sein 2024 in der edition suhrkamp erschienenes Buch »Warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen« überschrieben. De Weck war Chefredakteur der ZEIT, später Generaldirektor des Schweizer SFR und ist Mitglied des Zukunftsrats für Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk. In seiner Headline steckt Kampfgeist. Und ein Konflikt zwischen zweien, die eigentlich Verbündete sein sollten: der Journalismus und die Medien.
De Weck ist nicht der einzige, der sachkundig und ausführlich nachweist, warum der Demokratie eine Gefahr von bisher unverdächtiger Seite droht. Von Toronto aus analysierte Andrey Mir 2020 »The media after Trump: manufacturing anger and polarization«. Sein schauriger Befund im Buchtitel: »Postjournalism and the death of newspapers«.
Beschrieben werden die Hintergründe und Mechanismen eines Paradigmenwechsels. Mit gutem Journalismus kann man nicht mehr reich werden wie noch im 20. Jahrhundert. In der Aufmerksamkeitsökonomie rechnet sich nur noch das, was uns Algorithmen zuspielen. Sie kalkulieren, was uns aufregen könnte und daher so lange bei der Stange hält, bis wir auf unseren Geräten eine maximale Anzahl an kommerziellen Anzeigen wahrgenommen haben.
Natürlich kann man mit vielen Dingen, die im vergangenen Jahrhundert noch profitabel waren, heute kein Vermögen mehr machen, ein Geschäft nicht mehr verlustfrei betreiben. Niemand braucht mehr Faxgeräte. Auch Kunststopfereien gibt es (leider) nur noch wenige. Doch Journalismus ist nicht irgendein Produkt, nicht irgendeine Dienstleistung.
Die Säule wankt
Jahrzehntelang galt unabhängiger Journalismus, galten freie Medien neben dem Parlament, den Gerichten und der Exekutive als eine der vier Säulen demokratischer Gesellschaften. Weil sie den Mächtigen auf die Finger schauen, Skandale aufdecken, Parteiprogramme entschlüsseln, Konzernbilanzen nachrechnen oder die Arbeit von Interessensverbänden, von den Kirchen über die Gewerkschaften bis zu Lobbygruppen, kritisch hinterfragen.
Reporter:innen stellen Öffentlichkeit her, zum Beispiel bei Gericht oder in Gemeinderäten, wenn über die Vergabe öffentlicher Mittel entschieden wird. Journalist:innen berichten auch über lokale Vorkommnisse, die die Lebensumstände meist nur weniger Menschen beeinflussen, das dafür aber oft massiv. Im Idealfall sind diese Medien finanziell und damit auch redaktionell unabhängig, weil es ein funktionierendes Geschäftsmodell gibt. Gedruckte Medien werden einzeln gekauft oder abonniert, Inhalte durch Werbung finanziert.
Die Digitalisierung hat dieses Geschäftsmodell zerstört. Die vierte Säule wankt. Im Internet hat das bewegte Bild einen Siegeszug angetreten, Leser:innen wurden zu Nutzer:innen, viele bescheiden sich mit kostenlosen Inhalten ungeachtet ihrer Qualität. Zur Krise der Abonnements kommt die der Werbung hinzu, seit es für Marketingabteilungen viel effizienter ist eine maßgeschneiderte Zielgruppe über große Plattformen zu erreichen.
Sogar der Journalismus selbst hat Konkurrenz bekommen. Seit Meinung gleich viel gilt wie Sachkenntnis, sind die Nutzer:innen zugleich Kommentator:innen und Influencer:innen. Jede und jeder sendet überall und das fast gratis. Medien und Journalismus stecken unbestreitbar in einer Krise. Gleichzeitig ist kritische faktenbasierte Berichterstattung in Zeiten von dreist verkündeten Lügen (»Fake News«) und populistischer Propaganda wichtiger denn je. Denn ohne den Boden der Tatsachen, auf dem wir stehen, wenn wir unsere erwünschtermaßen unterschiedlichen Ansichten austauschen, ohne das Vertrauen in den geordneten öffentlichen Diskurs ist die Demokratie verloren.
Journalismusförderung von Anfang an
Die ERSTE Stiftung war sich der Bedeutung von kritischem Journalismus für eine funktionierende Demokratie seit Beginn ihrer Tätigkeit bewusst. So stellen wir mit dem Partner Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) seit 17 Jahren Stipendienprogramme für Investigativjournalist:innen in Osteuropa zur Verfügung. Zuerst in den Balkanländern, seit 2019 auch für die mitteleuropäischen Nachbarn Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn.
Wir wollten anfangs in Menschen, nicht in Medien investieren. Doch die schwierige Situation unabhängiger Medien vor allem in Osteuropa wurde immer offensichtlicher. Auch gut ausgebildete Journalist:innen brauchen Orte, um veröffentlichen zu können. Deshalb gehörte die ERSTE Stiftung zu den Gründern des europäischen Demokratiefonds Civitates. Seit 2019 fördert dieser Pool europäischer Stiftungen mit Sitz in Brüssel in einem seiner Sub-Fonds innovative Medien-Outlets mit einem Schwerpunkt in Ländern, die von einer Einschränkung der Medienfreiheit bedroht sind.
Eher kleinen, gemeinwohlorientierten Medienorganisationen hilft Civitates sich zu stabilisieren und zu wachsen. Für die Demokratie ist aber wenig gewonnen, wenn gleichzeitig reichweitenstarke Medien ihre Unabhängigkeit verlieren.
2023 haben wir uns daher entschlossen unser erstes Social Impact Investment in Pluralis zu platzieren, einem Mischkapitalfonds mit Sitz in Amsterdam, der osteuropäische Traditionsmedien auf ihrem Weg in eine profitable, digitale Zukunft begleitet und dabei Medienvielfalt stärken will. Investitionsziele sind profitable Legacy Medien, denen droht von Akteuren übernommen zu werden, die die redaktionelle Unabhängigkeit nicht mehr garantieren können oder wollen.
»Unabhängiger, kritischer Journalismus ist eine wichtige Grundlage für unsere Demokratie. In dieser akuten Medienkrise will ich mich gemeinsam mit renommierten Stiftungspartnern, Philanthrop:innen und Impact Investor:innen einsetzen, dass es künftig mehr tragfähige Geschäftsmodelle für Journalismus gibt.«
Martin Kotynek, Gründungsdirektor des Media Forward Fund
Das Medienökosystem in Österreich kann kippen
Diese Form von Investment durch gebündeltes, wirkungsorientiertes Stiftungskapital in Medien ist in reifen Märkten allerdings nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Denn die Gefahren in Ländern wie Deutschland, Österreich oder der Schweiz liegen nicht in der Einflussnahme durch interessegeleitete Eigentümer:innen (Media Capture), sondern in der eingangs beschriebenen ökonomischen Schieflage. In Österreich ist dieses Problem vielleicht sogar besonders ausgeprägt, weil es seit Jahren großzügige, aber nicht unbedingt an der Qualität orientierte Förderungen der öffentlichen Hand gibt, an die sich die begünstigten Medien gewöhnt haben.
Belohnt wird aber nicht Innovation, sondern Reichweite, die ja eigentlich profitabel sein sollte. Investigativ-Portale oder neue, digital basierte Plattformen bekommen oft gar keine Förderungen. Gerade diese bräuchten jedoch Unterstützung, weil sie kaum Werbegelder erhalten und Abos im Frühstadium oft ebenso schwierig zu bekommen sind wie Anschubfinanzierung. Expert:innen beschreiben die Situation der unabhängigen Medien in Österreich als problematisch.
Der Media Forward Fund schließt damit eine entscheidende Förderlücke in Österreich und ergänzt im Portfolio der Medienprogramme der ERSTE Stiftung die Fonds Pluralis und Civitates, die beide nicht in Österreich investieren. Die ERSTE Stiftung ist nun neben der deutschen Schöpflin Stiftung, der Mercator Stiftung Schweiz und dem Impact Investor Karma Capital zu einem der vier Gesellschafter und zur Mitinitiatorin des Media Forward Fund geworden.
Der gepoolte Fonds versammelte bis Ende 2024 bereits zwanzig internationale Stiftungen. Neben den deutschen und Schweizer Stiftungen sind aus Österreich noch die DATUM Stiftung für Demokratie und Medien dabei sowie die renommierten amerikanischen Stiftungen McArthur Foundation und Knight Foundation. Sie alle wirken mit an einem gesunden Medienökosystem für den DACH-Raum.

Bis zu 400.000 Euro für ein gutes Geschäftsmodell
Die Zielsetzung ist klar umrissen: Der Media Forward Fund fördert unabhängige Qualitätsmedien mit tragfähigen Geschäftsmodellen, die starke und vertrauenswürdige Inhalte veröffentlichen und sich langfristig nachhaltig finanzieren können. Besonderes Augenmerk liegt auf Medien, die Lücken in der überregionalen und nationalen Berichterstattung sowie in thematischen Nischen füllen, Lücken in der regionalen und lokalen Berichterstattung schließen (sogenannte Nachrichtenwüsten) und sich an bislang oder mittlerweile unterversorgte Zielgruppen richten.
Für kleinere Medienhäuser mit bis zu 30 Mitarbeiter:innen gibt es Organisationsförderung oder eine Projektkooperation, je nachdem ob es sich um gemeinnützige oder gemeinwohlorientierte For-Profit-Organisationen handelt. Das Fördervolumen umfasst in der Regel bis zu 400.000 EUR für zwei Jahre. Große Medienhäuser werden unterstützt, sofern sie das Projekt in einem 50:50-Verhältnis mitfinanzieren. Der Fund steht für Projekte ab »nach der Ideenphase« offen, also sobald ein Businessplan und im Idealfall auch schon ein erster Test des Product/Market-Fits vorhanden sind. Eine unabhängige Jury prüft vor allem das Transformationspotenzial durch eine Förderung, ob ein tragfähiges und zukunftsfähiges Geschäftsmodell in Aussicht steht, das Skalierungspotenzial und ob die angestoßenen Entwicklungen nach Förderende verstetigt werden können.
Ohne einen funktionierenden Medienmarkt geht es nicht
Die geförderten Medien sollen also so rentabel gemacht werden, dass sie sich dauerhaft selbst finanzieren können. Denn wir brauchen für ein gesundes Medienökosystem und damit für eine stabile Demokratie dringend profitable Medien. Andernfalls gibt es bald keine unabhängigen Medien mehr und Algorithmen basierte, KI getriebene Fake-News-Generatoren auf amerikanischen, russischen oder chinesischen Plattformen bestimmen, welche Nachrichten wir erfahren oder nicht.
Natürlich könnte die öffentliche Hand gemeinnützigen Journalismus fördern. Doch so wichtig ein funktionierender öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, so wenig darf Qualitätsjournalismus in seiner Vielfalt allein Sache des Staates sein, wenn er seine Watchdog-Rolle erfüllen soll. Wie angreifbar Medien sind, wenn sie sich massiv auf öffentliche Förderungen verlassen, hat sich in Österreich in den gescheiterten Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP Anfang 2025 gezeigt, in denen eine rigorose Medienpolitik als ein Mittel der Parteipolitik vorgesehen war, zu Lasten von Pressefreiheit und Faktentreue.
In der Slowakei wiederum behaupten sich kritische Medien wie SME (im Portfolio von Pluralis) und Dennik N nur deshalb, weil sie nicht auf öffentliche Förderung angewiesen sind. Daher muss es einen funktionierenden privaten Markt für Medien geben. Dafür müssen sich diese auf die Bedürfnisse der Konsument:innen einstellen und schlüssige Geschäftsmodelle finden. Die erfolgversprechenden will der Medien Forward Fund fördern.
Gepoolte Fonds als Förderinstrument für Stiftungen
Gepoolte Fonds wie Civitates und der Media Forward Fund sind für gemeinnütze Stiftungen ein besonders sinnvolles Instrument, um Medien zu fördern. Eine unmittelbare Unterstützung ist oft nicht möglich und auch für beide Seiten nicht erstrebenswert. Als österreichische Sparkassen-Privatstiftung darf zum Beispiel die ERSTE Stiftung nur Non-Profit-Organisationen fördern oder in Social Impact Fonds investieren. Das ist wenig hilfreich, wenn mit der Förderung Medien zur Profitabilität verholfen werden soll. Zum andern stehen oft Interessenskonflikte und Reputationsrisiken im Raum. Unterstützt man ein Medium, das einen Fehler macht, kann das auf die Stiftung zurückfallen. Von externen Geldgebern abhängige Medien laufen wiederum Gefahr ihre Glaubwürdigkeit bei der Leserschaft zu verlieren.
Gepoolte Fonds schaffen hier eine schützende Brandmauer und sind die gemeinnützigen Organisationen, die Stiftungen satzungsgemäß fördern können. Außerdem stellen sie die personellen Ressourcen und unabhängigen Fachjurys, die einen fairen, maximal professionellen Ablauf bei Ausschreibungen garantieren. Die Förderentscheidungen des Media Forward Fonds können von den Stiftungen nicht beeinflussen werden. Auch hier wird also der Verdacht entkräftet, man wolle sich in Berichterstattung einmischen.
Dennoch zögern immer noch viele Stiftungen in die Förderung von gemeinwohlorientierten Medien einzusteigen. Dabei sollte jede gemeinnützige Stiftung ein Interesse daran haben, dass es eine funktionierende Medienlandschaft gibt. Denn wenn wir die Medien verlieren, wo soll dann die öffentliche Debatte über die Kernthemen stattfinden, die eine Bildungs-, eine Kultur- oder eine Umweltstiftung hauptsächlich verfolgt?
Das Ergebnis der ersten Ausschreibung 2024
An der ersten Ausschreibung des Media Forward Fund im Sommer 2024 haben sich 136 Medienunternehmen beteiligt: 57% aus Deutschland, 26% aus der Schweiz und 17% aus Österreich. In einem mehrstufigen Verfahren wurden am Ende 10 Organisationen persönlich nach Berlin eingeladen, um ihre Bewerbung der unabhängigen Fachjury zu präsentieren. Insgesamt wurden 1,49 Mio. Euro an vier Organisationen vergeben. Zwei der Geförderten sind aus der Schweiz, zwei aus Österreich:
Mit dem Schweizer Lokalmedium Tsüri aus Zürich, das seit mehr als 10 Jahren für eine überwiegend junge Zielgruppe berichtet, geht der MFF eine Kooperation mit einem finanziellen Beitrag von 400.000 Euro ein. Damit soll in Workshops und Prototypen herausgefunden werden, wie ein hyperlokales Nischenthema den Vertriebskanal zur Mitgliedschaft vergrößern kann.
Das Schweizer Investigativmedium Reflekt aus Bern, das seit mehr als fünf Jahren regelmäßig Missstände aufdeckt und damit gesellschaftlichen Impact erzielt, wird mit 300.000 Euro gefördert. REFLEKT möchte seine Vertriebskanäle (Funnel) verbreitern, indem sie gemeinsam mit reichweitenstarken Hosts ihre investigativen Recherchen in Social Videos zugänglich machen. Die so gewonnenen Nutzer:innen sollen dann über ein Crowdfunding zu zahlenden Unterstützern werden.
Das österreichische Medienhaus andererseits aus Wien, bei dem Menschen mit und ohne Behinderungen seit 2022 in einer inklusiven und Community-basierten Redaktion für ein Print-Magazin, zwei Newsletter und investigative Recherchen schreiben, wird mit 400.000 Euro gefördert. Andererseits möchte seine Vertriebskanäle zum Abo durch einen themenspezifischen Newsletter für die »underserved community« der Menschen mit Behinderung vergrößern. Durchgestartet ist andererseits übrigens im Gründungjahr mit einer vielbeachteten Dokumentation der ORF-Spendenaktion »Licht ins Dunkel«, die die ERSTE Stiftung unterstützt hat.
Das österreichische werbefreie Investigativmedium Dossier aus Wien, das seit mehr als zwölf Jahren über Korruption, Ausbeutung und Machtmissbrauch berichtet, wird mit 390.000 Euro gefördert. Dossier möchte seinen Funnel zur Mitgliedschaft vergrößern, indem investigative Recherchen auf die Theaterbühne gebracht werden. Die ERSTE Stiftung hat einmalig eine Dossierausgabe zum wichtigen Thema Pflege unterstützt. Jetzt freuen wir uns über die strukturelle Förderung für Dossier durch den Media Forward Fund.
Die unabhängige Jury bestand aus fünf fachkundigen Mitgliedern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit internationaler Perspektive und vielfältiger Expertise: Yves Daccord (Journalist, ehemaliger Generaldirektor Internationales Rotes Kreuz, Investor Le Temps und Heidi News), Maria Exner (Gründungsintendantin Publix/Berlin, ehemalige Chefredakteurin ZEIT-Magazin), Evelyn Hemmer (COO Hashtag Media, Gründerin der Wiener Medieninitiative), Lucy Küng (Senior Research Associate am Reuters Institute for the Study of Journalism der Universität Oxford, Verwaltungsratsmitglied der Neuen Zürcher Zeitung), Eva Schulz (Gründerin des funk-Videokanals »Deutschland 3000«).
Titelbild: Foto von Roman Kraft auf Unsplash