Journal
Dezember 5, 2024
Lesezeit: 6'

20 Jahre Kontakt
Kontakt wurde 2004 als gemeinnütziger Verein von der ERSTE Stiftung in Kooperation mit der Erste Group gegründet. Der Ausgangspunkt lag in der Erweiterung der Erste Group in Länder des ehemaligen Osteuropas. Dies war jedoch nur ein Anhaltspunkt, der für den seit Beginn eingesetzten Kunstbeirat als Ansatz galt, an der Entstehung einer konzeptuell ausgerichteten und kunsthistorisch fundierten Sammlung zu arbeiten, die parallel bzw. ergänzend zu einer westlich geprägten Kunstproduktion gesehen werden kann.
Ein aus der Sicht der Kunst wesentlicher Beweggrund war die Dringlichkeit, Werke der sogenannten osteuropäischen Neoavantgarde zu sichern, nachdem sich weder öffentliche Museen noch Privatsammlungen für Arbeiten interessierten, die der dissidenten Kunstpraxis in Osteuropa zuzurechnen sind.
Bereits in den ersten Sammlungsjahren konnte Kontakt eine große Anzahl bedeutender konzeptueller, performativer und medienreflexiver Arbeiten der 1960er- und 70er-Jahre aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa ankaufen, die erstmals 2006 in einer Ausstellung im mumok und 2007 im Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Belgrad zu sehen waren. Diese Schlüsselwerke der osteuropäischen Neoavantgarde bilden den Bezugsrahmen, von dem aus Kontakt weiterentwickelt und als eine der bedeutendsten Sammlungen der Kunst Mittel-, Ost- und Südosteuropas etabliert wurde.
Während in den ersten Jahren das Sichern und Sammeln im Vordergrund stand, kam nach 2014 die wissenschaftliche Erforschung und Dokumentation der bis dahin unzureichend wahrgenommenen osteuropäischen Kunst hinzu. Kontakt ging es dabei nicht nur um eine Neuformulierung und Korrektur des bestehenden westlich determinierten (Kunst-)Geschichtsbildes, sondern auch um die Einschreibung der Kunst des ehemaligen Osteuropas in eine »globale« Kunstgeschichte. Dies erfolgte zunächst mit der Aufarbeitung des Oeuvres des 1939 geborenen slowakischen Künstlers Július Koller, der zu den herausragenden Künstlern der Neoavantgarde zählt und von dem Kontakt zentrale Werke der 1960er- und 1970er-Jahre erwerben konnte.
Mit der Erforschung von Stano Filkos installativer Arbeit »White Space in White Space«, die er gemeinsam mit Miloš Laky und Ján Zavarský 1973 realisierte, und der Aufarbeitung des Oeuvres des 1944 in Shkodër geborenen albanischen Künstlers Edi Hila setzte Kontakt die wissenschaftliche Untersuchung osteuropäischer Kunst fort und veröffentlichte die Ergebnisse als englischsprachige Publikationen.
Im Bemühen, diese noch nicht erzählten Geschichten der Kunst des ehemaligen Osteuropas zu schreiben und nach neuen interpretativen Ansätzen zu suchen, durch die auch »dislozierte Ähnlichkeiten« der Kunst des ehemaligen Ostens und Westens erforscht werden können, erfüllt Kontakt die programmatischen Zielsetzungen, die die Kunstbeiratsmitglieder Silvia Eiblmayr, Georg Schöllhammer, Branka Stipančić, Jiří Ševčík und Adam Szymczyk mitentwickelt haben. So sieht Jiří Ševčík in der Sammlung von Kontakt mit ihren über 1300 Werken von 160 Künstler:innen ein »einzigartiges Monument kultureller Erinnerung«, das möglicherweise eine entscheidende Rolle in den radikalen Veränderungen des gesellschaftlichen und politischen Lebens spielen wird, die uns noch bevorstehen.
Ševčíks Reflexion der Geschichte und sein Hinterfragen der utopischen Momente und Ideale unserer jüngsten Vergangenheit, und zwar jener Momente, die den Kontakt-Kunstwerken eingeschrieben sind und die damit einhergehenden Versuche einer Demokratisierung implizieren, sowie ihre Bedeutung für die Zukunft, wird aus seiner Sicht einen wesentlichen Beitrag für das Weiterbestehen einer offenen, demokratischen Gesellschaft leisten. Die Suche nach alternativen Sicht- und Handlungsweisen, oder, um es in den Worten Július Kollers zu formulieren, nach einer »neuen kulturellen Situation« kann angesichts der gegenwärtigen existenziellen Krisen nur als eine Aufgabe von größter Dringlichkeit verstanden werden.
Kontakt nimmt das 20-jährige Jubiläum zum Anlass, Fragen nach möglichen Zukunftsszenarien aus künstlerischer und institutioneller Perspektive zu stellen, und deren Diskussion in den Mittelpunkt der Projektvorhaben für 2024 zu rücken. Wie lässt sich vor dem Hintergrund von Klimakatastrophen und Ressourcenknappheit Sammlungs- und Ausstellungsarbeit überhaupt noch begründen und zukunftsfähig gestalten?
Besondere Bedeutung wird dabei der sogenannten dematerialisierten Kunst beigemessen, die prominent in der Sammlung vertreten ist: Mail-Art, Performances, Happenings, experimentelle Poesie und Soundarbeiten aus den 1960er- und 1970er-Jahren, die auf Papier, in Filmen und auf Fotografien festgehalten worden sind: künstlerische Ideen und Gedankenexperimente, die Darstellung und Form finden können, aber nicht zwingend physisch umgesetzt werden müssen.
So hat etwa Július Koller, der mit seiner dematerialisierten Kunst ein flexibles und operatives Werkzeug zur Initiierung eines kritischen Diskurses unter dem damaligen kommunistischen Regime schuf, gleichzeitig eine Möglichkeit gefunden, Kontakt mit Künstler:innen innerhalb und außerhalb Osteuropas aufzunehmen, indem er Appelle und Mitteilungen auf Postkarten und Telegrammen in die Welt versandte, um so Vorstellungen und Anregungen einer alternativen Zukunft für die Weltgemeinschaft zu verbreiten.
Für die Gründungsmitglieder der Sammlung galt daher die Werkserie Kollers mit dem Titel »KONTAKT (Anti-Happening)« als Anstoß für ihre Entscheidung, den Begriff »Kontakt« zum Sammlungsnamen zu machen. Er gilt als Hommage an das Werk jener Künstler:innen, die mit ihren künstlerischen Projekten, Dokumenten und Aktionen der allgemeinen gesellschaftlichen Passivität nach dem Scheitern des Prager Frühlings zukunftsweisende Alternativen aufzuzeigen versuchten.
Eine ähnliche gesellschaftliche Passivität ist heute in ganz Europa zu beobachten – eine Haltung, die mitverantwortlich gemacht werden muss für die scheinbar vorherrschende Demokratieverdrossenheit und das subjektive wie institutionelle Versagen vor den Herausforderungen beispielloser Klimakatastrophen und ihrer Ursachen. Die Dringlichkeit von Konsequenzen im Bereich der Kunst wird nicht zuletzt auch durch das Ausmaß deutlich, in dem der internationale Kunstbetrieb und seine Institutionen sich in den letzten Jahren zu einem signifikanten Verursacher von CO2-Emissionen und Energieverbrauch entwickelt haben. Wie kann sich eine Sammlung als Kunstinstitution dazu verhalten? Welche systemischen Veränderungen im Kunstbetrieb sind notwendig und vorstellbar?
Kontakt wird das Jubiläumsjahr für den Versuch nützen, die utopischen Momente und Ideale, die in die dematerialisierte Kunst Osteuropas der 1960er- und 1970er-Jahre eingeschrieben sind, zu erforschen und in Ausstellungen im Museum moderner Kunst in Warschau und im Pariser Palais de Tokyo sowie in einem Filmprojekt im Rahmen des Docufest in Prizren (Kosovo) zu aktivieren. Statt repräsentativer Ausstellungen mit fertigen Kunstpräsentationen soll der ideelle, gedankliche Entstehungsprozess von Kunst in den Vordergrund gestellt werden, der weder CO2-emissionsintensive Kunstwerktransporte noch ein materialaufwändiges Ausstellungsdisplay zur Voraussetzung hat.
Anmerkung der Redaktion: Das Filmprojekt im Rahmen des Docufest Prizren wird im August 2025 stattfinden.
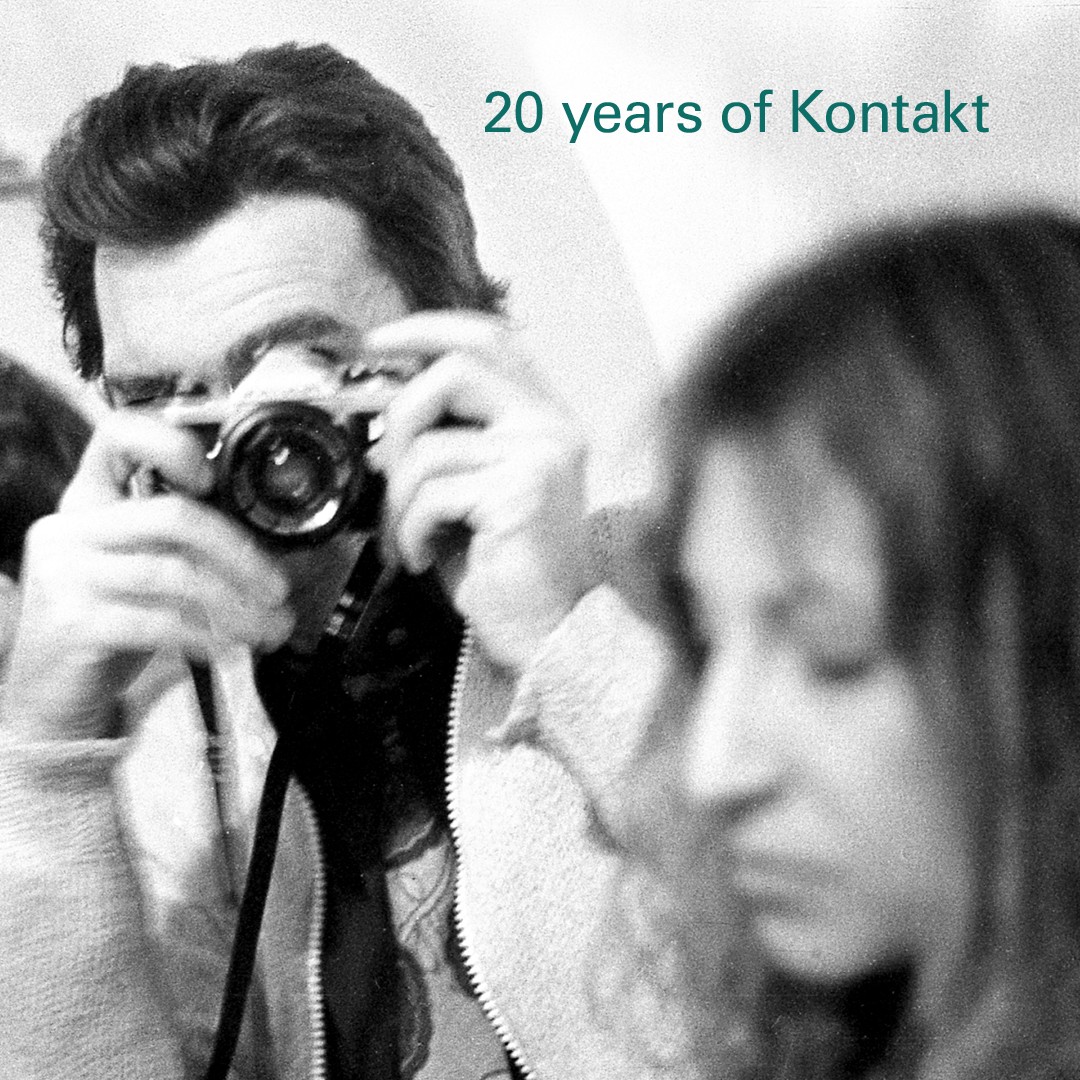
Titelbild Aktivierung von Július Kollers Werk »Universal Futurological Question Mark (U.F.O.)«, 1978, in Warschau am 18. September 2024. Foto: Karolina Pawelczyk.



